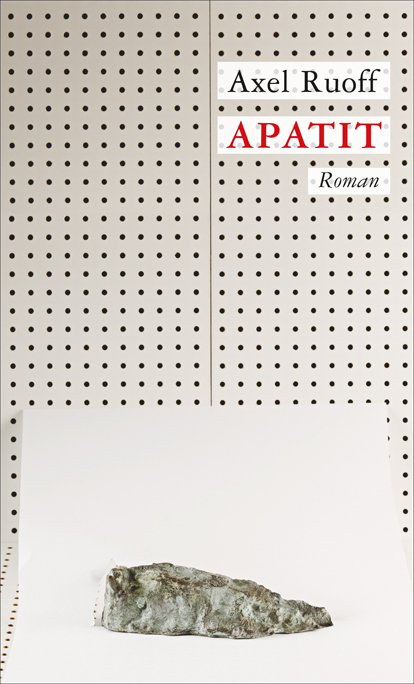Apatit
Roman
Literaturpreis der A und A Kulturstiftung 2018
Aufgenommen in die Shortlist für den Rauriser Literaturpreis 2016
Apatit, von altgriech. apatan, "täuschen, trügen". Nicht näher bestimmte Mineraliengruppe der Klasse der Phosphate. Ermöglicht dem Organismus Wachstum, bringt jedoch im Übermaß jede Entwicklung zum Stillstand.
Staub geht ununterbrochen auf das wüste, kolonial zerwühlte Land nieder, in das eine Frau und ein Mann nach dem fluchtartigen Verlassen des europäischen Kontinents geraten sind. In der unberechenbaren Natur, in der die Koordinaten von Zeit, Raum und Identität aufgehoben scheinen, wird die Hoffnung der Reisenden fragwürdig, sich hier aus den Zwängen ihrer Herkunft, den Beschränkungen ihrer Kultur zu befreien. Vorfälle in dem einzigen, versandenden Hotel des Ortes bleiben undurchschaubar, alles täuscht vor, etwas anderes zu sein, als es ist. Die Reisenden, die dem trügerischen, unwirtlichen Landstrich immer mehr verfallen, überlassen sich Phantasien, Erinnerungen und eigenwilligen Gewohnheiten. Und doch folgt das Unvorhergesehene und Unzumutbare ihrer Irrfahrt der Spur der Vergangenheit, der sie zu entkommen suchen …
Roman. 344 S.
Verlag Bibliothek der Provinz
ISBN: 978-3-99028-418-6
Rezensionen
Alban Nikolai Herbst
Stein aus Frau
Die künstlerische Verwandlung einer Statue in einen Menschen ist, seit der mythische Bildhauer Pygmalion auf Zypern dieses Wunderwerk vollführte, immer wieder imitiert und variiert worden. Der umgekehrte Weg, nämlich der in die mineralische Erstarrung, ist wegen geringerer Attraktivität nicht gerne beschritten worden. Axel Ruoff aber hat das in seinem Roman „Apatit“ mit guten zeitgenössischen Gründen gewagt, und Alban Nikolai Herbst ist davon beeindruckt.
Axel Ruoffs beklemmend-grandioser Roman »Apatit«
-sie war jetzt ein er, ein Zustand,
und war eine sie, eine Erschöpfung.
Und er und sie wollten es werden- Apatit, 273
Hier ist alles, nahezu alles, enggeführt. Ein Paar – S und R genannt, für er und sie, dabei sie vermutlich nichteuropäischer Herkunft – reist flüchtend von Nordeuropa in den Süden, fluchthaft indes nicht. Sie wollen hinter sich lassen, sie einen schweren Mißbrauch, er man-weiß-nicht-was, und lassen sich dabei das, was zunehmend Zentrum des Romanes wird: Zeit. Dabei ist ihrer beider Nähe von vornherein provisorisch, lebt von einer Zukunft, die bereits in der Gegenwart Erinnerung ist, es jedenfalls immer mehr wird. Wobei sich die Zeit auch mehr in ihr als in ihm zusammenzieht, schon weil er, anders als sie, bis zum Ende des Buches menschliche Kontakte unterhält, mithin kommuniziert, was eben sie nicht mehr tun möchte – so wenig, daß sie sich als Zeit im Wortsinn schließlich feststellt. Das bitter erfahrene Trauma führt in die ewige Schmerzlosigkeit. In einer Art Traumsequenz wird diese überdies geheiligt, eine Szene, die einiges von erlangter Erlösung hat und eben zeigt, wie verloren alle die Bewohner des Wüstenortes sind, in den S und R schließlich gelangten:
Als sich vom Gehsteig die Treppe hinauf bis in Rs Zimmer eine Schlange von Menschen gebildet hatte, die sich anstellten, um die Steinfrau zu sehen, plötzlich Hoffnung hatten oder den Mut, ihre Wünsche auszusprechen, verwandelte sich das Hotelzimmer in ein Tempelgemach, in dem alles so zu belassen war, wie man es nach dem Wunder vorgefunden hatte, und das von den Kräften der Verwandlung aufgeladen war, und so wurde sie zu einer Bewohnerin der Ewigkeit, die mit den Göttern zeitlose Gefilde teilte, obwohl sie hatte beweisen wollen, dass auch Steine sich veränderten, wuchsen und keine bloßen Produkte ewigen Zerfalls, sondern ewigen Werdens waren (…) Apatit 330
So auch wird das titelgebende Mineral als eines beschrieben, das dem Organismus Wachstum ermögliche, jedoch im Übermaß jede Entwicklung zum Stillstand bringe. Insofern ist dieser Text – zumindest gegen Ende – ein durch und durch religiöser, wenngleich nicht christlicher, insgesamt weniger monotheistischer (worauf die bisweiligen Kafka-Ankläge deuten könnten) als naturmythischer. Nur daß es keinerlei Verklärung von Natur gibt. Im Gegenteil, über diese (Heinrich Mann:) „kleine Stadt“ fällt die Natur unerbittlich her, ob es die wimmelnden Fliegen, ob Heerscharen von Schaben sind, ob es der allgegenwärtige Sand ist, ob der Staub oder die unablässige Hitze. Die Wahrnehmungen verschwimmen, besonders die in der Landschaft lösen sich auf und greifen eine/n aber dennoch an, und umso mehr. Es gibt keine Rettung außer Ergebung:
Landschaft und Klima standen in so enger Wechselwirkung, dass sie einen Raum bildeten, der in sich veränderlich war, sich weitete oder verengte, sich in die Länge zog oder so verzerrte, dass der Himmel bis zur Unkenntlichkeit nahekam, in sandgrauer Körnigkeit auf die Körper herabdrängte und alles unter Druck setzte, was sich aus der Horizontalen gewagt und aufgerichtet hatte, dieser Raum legte sich um alles, als wollte er es anfassen, abtasten und absuchen, aus göttlicher Willkür, Bosheit und parasitärer Lust zerdrücken, ein bedrohlich hinterhältiger Raum, der sich allem wie eine verschwitzte, abgeworfene Haut aufdrängte, als ob sie immer noch passen müsste und die Menschen in Erinnerungen eingeschlagen würden, die nicht die ihren waren. Apatit, 143
Dabei sind Landschaft und menschliche – im Sinn von unmittelbarer Historie – Geschichte auf das engste verbunden, interdependent. Das namentlich nicht genannte Wüstenland war ausgebeutetes Kolonialgebiet und nun, nach dem Rückzug der Europäer, ist es vom Nachbarstaat besetzt und wird rücksichtslos weiter, seiner Bodenschätze wegen, ausgesogen. Es ist überdies außer von Norden nicht oder nur unter großen Risiken zugänglich, einseits sogar von einer endlosen, vermittels Forts überwachten Mauer von der Moderne weggetrennt und leidet schwer unter Kriegs- und Aufstandsfolgen. Insofern befinden wir uns durchaus nicht in einem nur-literarischen, wenngleich zwar auch-allegorischen Raum, sondern mitten in der bittersten Konkretion wenn nicht unserer eigenen, so doch der augenblicklichen Gegenwart unseres halben Planeten. Und ebenso konkret ist die Traumatisierung der Frau durch den Mißbrauch, für den Ruoff geradezu ungeheure, durch Empathie, Formulierungen findet, die „Bilder“ zu nennen grob euphemistisch wäre:
Solange sie auf europäischem Boden gelebt habe, habe sie in der ständigen Angst gelebt, diesem Mann zufällig zu begegnen, von ihm ausfindig gemacht, trotz rasierten Kopfes wiedererkannt und aufs Neue misshandelt zu werden, dieser Mann müsse sie hassen, weil sie ihn ins Gefängnis gebracht habe, die Beweislage sei jedoch so eindeutig gewesen, dass nicht ihre Aussagen den Ausschlag gegeben hätten, sondern das medizinische Gutachten, die sichergestellten Sachbeweise und die Verhöre des Angeklagten, der jede Schuld von sich gewiesen und behauptet habe, ihren Annäherungsversuchen und ihrer sommerlichen Kleidung erlegen zu sein, er habe keineswegs schlechte Absichten verfolgt, sondern ihretwegen den Verstand verloren, der ihn von einer solchen Tat abgehalten hätte, wenn sie ihn nicht über die Maßen gereizt hätte. Bei der nächsten und letzten Begegnung werde S in seine höhnisch mitleidigen Augen blicken, die gierig darauf lauerten, die einzige Zeugin zu vernichten und seine Unschuld wiederherzustellen, um der Verführerin, die ihn erniedrigt habe, die Kehle zuzudrücken, nachdem er ihr mit Zigaretten das Geständnis aus dem Leib gebrannt hätte, dass sie gewollt habe, was passiert sei, um sie so auf eine Vergangenheit festzunageln, in der er ihr unterlegen, er verführt, nicht sie geschändet worden sei. Apatit, 93/94
So gestaltet Ruoff sei's im Verhältnis der Menschen zu einer Landschaft außer Menschenmaß, sei's in S's unentwegter, im Wortsinn gestoßener Beklemmung die Innenlogik von Opfern, denen schließlich nichts als Affirmation, also die Ergebung bleibt. Ihrer will sich S, und mit ihr R, anfangs noch entziehen, schon das Verhältnis der beiden selbst ist eine Flucht. Bis sie beginnen, Steine zu sammeln. Das Motiv der Steinwerdung ist insofern sehr früh schon angelegt, und zwar ebenfalls über das Mißbrauchstrauma:
(…) sie leistete Widerstand, gab ihren leblosen Körper noch nicht an dieses Scheusal verloren, von Wut ergriffen, sank ihre Seele tiefer, ließ sich in einem Stein nieder, um ihren Verfolger zu zertrümmern, entmannte alles, was sich ihrer bemächtigen wollte, denn der Rachedurst hatte diesen Abstieg ins Mineralische überlebt, war im Stein nicht vergangen,
und jetzt die infame, das Opfer geradezu verdinglichende Conclusio dieser Logik:
(…) mineralischer Kräfte, der Kräfte der Erde bedurfte sie, sich von allem Menschlichen möglichst weit entfernt zu inkarnieren, um von den Erniedrigungen der Vergangenheit nicht mehr verfolgt zu werden (…). Apatit, 102/103
Doch fängt es mit den Steinen schon auf der S. 27 an, der überall auf dem Boden verstreute Gesteinsbruch und der Abfall eines Kieswerks. Daß die beiden, S und R, in einer der atemberaubendsten Szenen dieses Romanes, die ganz spielerisch anhebt – wenn ausgerechnet ein Kind, ein scheinbar argloser Junge, ihnen zum Stadtführer wird – von sich zur Rotte ballenden anderen Kindern gesteinigt werden, bis ihnen, S an der Stirn getroffen, nur noch durch sich selbst gefährdendes Einschreiten einiger Eltern die panischste Flucht zurück in ihr Hotel gelingt – dies ist von furchtbarster Folgerichtigkeit der Parabel, nur eben nicht nur einer Parabel, sondern wiederum von konkreter Erfahrung, die der Reisende wohl kennt, der schon durch Slums der sogenannten Dritten Welt spaziert. Mich selbst hat einst in Mumbai der von einem Jungen aus einer Zwille abgeschossene Stein an der Stirn getroffen und, kurzfristig ohne Bewußtsein, zu Fall gebracht. Es ist gerade die Engführung von Konkretion und Parabel, was Axel Ruoffs „Apatit“ derart eindringlich macht und seinen Roman vor vielen anderen Büchern auszeichnet. Vor allem aber ist es sein gleichermaßen kunstfertiger wie aber auch derart penibler Stil, daß sich von Ästhetizismus sprechen ließe, würde das Unheil nicht derart deutlich benannt. Kurz, es findet keine ästhetische Verklärung statt, selbst die Heiligung der am Ende zur Stein gewordenen Frau hebt Ruoff als falschen Traum wieder auf und überführt sie in eine mehr als minder hilflose kriminaltechnische Untersuchung:
(…) der Kommissar wolle nicht Autopsie sagen, weil er nicht wisse, ob dieser Stein lebe, aber für ihn sei aus beruflichen Gründen nicht statthaft, an wunderliche Verwandlungen zu glauben, und seien sie auch krankhafter Natur, für ihn sei es naheliegender, an Säure zu glauben, mit der R die Frau übergossen und in diesen Zustand gebracht habe und die er problemlos von dem säurekundigen Apotheker habe erhalten können, mit dem er regelmäßig in Gespräche, ja Wortgefechte vertieft gesehen worden sei (…) Apatit, 333
Das eigentliche Geheimnis dieses Stils besteht aber darin, daß er selbst ein Ausdruck des titelgebenden Minerals ist, des Apatites also, dessen Name sich vom altgriechischen apatan herleitet: „täuschen“, „trügen“. Dies wird so auf der Rückseite des Buches zwar erklärt – und dennoch glauben wir ständig, sehr lange Sätze, eine geradezu kleistsche Abfolge von Hypotaxen zu lesen. Womit der Apatit uns narrt, ganz wie in der Erzählung der Landschaft die Konturen zerfließen, bzw. sich im Staub und Flirren unter der Sonne ineinander auflösen. Tatsächlich handelt es sich nämlich um aneinandergekettete, heißt: allein durch Kommata sowohl segmentierte wie aneinander enggeführte Parataxen, mithin um, je für sich genommen, bisweilen sogar recht kurze Hauptsätze. Doch bewirkt die Kommatrennung, daß man den folgenden sehr oft erst einmal als Nebensatz des vorherigen Hauptsatzes liest, bis wir merken, längst wieder in einem solchen zu sein – ein stilistisches Verfahren, daß aus der Chronologie des Erzählten, ja auch der Sukzession-selbst ein herrschendes, mehr noch: sich ballendes, sich erschreckend komprimierendes Kontinuum macht und die Organik, kurz: das Leben, so sehr verdichtet, bis es ist, was die Frau dann tatsächlich wird: Bewegungslosigkeit, Stein, Stille, Nullpunkt.
Darüber mehr sollte hier geschrieben nicht werden. Denn Dichtung läßt sich nicht referieren. Sie läßt sich nur erfahren.
ANH – Amelia/Umbrien, Juni 2018
faustkultur (https://faustkultur.de/3561-0-Alban-Nikolai-Herbst-Axel-Ruoff-Apatit.html)
Alban Nikolai Herbst
“Apatit” und die Erzählung von einem „Preisverleih“
(...) Jetzt zu etwas, das mich gestern abend schwer beeindruckt hat: Axel Ruoffs Roman Apatit, der soeben den Preis der A & A Kulturstiftung erhalten hat. Die Laudatio hielt Uwe Schütte (...). Eine grandiose Laudatio (...) , auch wenn sie vielleicht ein wenig zu viel vom Inhalt des Buches verriet, sozusagen den Saisschleier hob, was Leser:innen wohl lieber selbst tun möchten. Andererseits drang Schütte eben dadurch tief ins Gewebe dieses Romanes ein – wie tief, zeigte hernach Anne Tismers und Dominik Benders bisweilen fast szenisch wirkende Lesung, die trotz ihrer Länge – Schütte hatte fast vierzig Minuten gesprochen, und vor ihm s c h o n jemand – nicht einen Moment lang an Konzentration sowohl der Vortragenden als auch vor allem des Publikums verlor.
Welch Präzision der Sätze! und auch der Grammatik! dachte ich, welche, zugleich, enorme Bildhaftigkeit, die dabei etwas Parabelhaftes bekommt, etwas ÜberIndividuelles – alleine dadurch, dass sich der Text so sehr auf die Objekte konzentriert, aufs Anorganische, dem sich die weibliche Protagonistin offenbar zunehmend annähert, bis sie eines mit ihm wird. Alles dies aber zugleich in eine Landschaft eingebettet, deren politisches Schicksal von modernster Aktualität ist, darin wiederum das allmähliche Versteinern einer ob nun möglichen, ob unmöglichen Liebe sich kristallisierend. Es ist gleichsam, als würde ein erlittenes Trauma ins Mineral überführt. Gewiss, dies hat ästhetische Kälte, eine, die sich der Hitze des wahrscheinlich afrikanischen Landes entgegenstellt, sich als Ästhetik nämlich behauptet. Entsprechend ausgeformt ist die Prosa. Ich musste an Nietzsches Bemerkungen denken.
Um Vers, Bild, Rhythmus und Reim hat man sich redlich zu bemühen – das begreift auch der Deutsche und ist nicht geneigt, der Stegreif-Dichtung einen besonders hohen Wert zuzumessen. Aber an einer Seite Prosa wie an einer Bildsäule arbeiten? – es ist ihm, als ob man ihm etwas aus dem Fabelland vorerzählte.
Der Wanderer und sein Schatten, 95
Axel Ruoff ist da aus dem Fabelland n i c h t s vorerzählt. Bezeichnend allerdings, dass sein Roman quasi untergegangen war, bis jetzt diese Stiftung einschritt – ein wirklicher Glücksfall für die Romandichtung, doch auch für mich und nun auch für Sie, die wir sonst kaum je von „Apatit“ gehört hätten.
Die musikalische Begleitung, am Solo-Bass, besorgte Greg Cohen, der (...) Bassist von Tom Waits. (...) Cohen ist wie Ruoff mineralogisch interessiert – was übrigens beide mit den Hauptvertretern der deutschen romantischen Literatur verbindet, und seine, Cohens, zuletzt dargebrachten Solostücke waren Mineralien auch gewidmet, die er übrigens mitgebracht hatte, links neben der Bühne zur Ansicht ausgestellt.
Ich aber schließe heute nur mit e i n e m – dem, das Ruoffs Buch seinen den Buchmarkt sicherlich nicht entzückenden Titel gab:

Bildquelle: Wikipedia
Alban Nikolai Herbst (https://de.wikipedia.org/wiki/Alban_Nikolai_Herbst)
https://dschungel-anderswelt.de/20180428/axel-ruoff-apatit-omar-galliani-roter-salom- volksbuehne-a-a-kulturstiftung-uwe-schuette-greg-cohen-arco-verlag/Anke Bennholdt-Thomsen
Dieser Roman ist ein sprachliches Ereignis
Ein Mann aus Europa (R.) und eine Frau aus Ostasien (S.) haben den europäischen Kontinent verlassen und sind an einem unwirtlichen, steinigen und dunstigen Ort gelandet, einer militärischen Sperrzone (vermutlich Marokko). Das ganze Terrain ist von politischer Vergangenheit geprägt, von zwei Besatzungen nacheinander mit ihren militärischen und zivilen Bauten. In ihm werden Phosphatvorkommen, vor allem Apatit abgebaut. Dieses Mineral, dessen Name vom griechischen Wort für ‚täuschen‘ abgeleitet ist, verweist auf die Erfahrung der beiden Ausländer, deren Wahrnehmungen nicht nur auf fremde, sondern zugleich verwechselbare Wirklichkeiten treffen. So sind sie etwa hartnäckig dem möglichen Befund auf der Spur, daß das Hotel, in dem sie bleiben, ein Krankenhaus war und ist. Als Gesprächspartner kommen nur ein forschender Apotheker, ein origineller Lokalbesitzer mit seinen Brüdern, seine regelmäßigen Kunden sowie ein Hotelportier in Frage, dessen Augen für S. die eigene Vergangenheit heraufbeschwören. Ein strukturierender Faktor des Romans ist nämlich die Erinnerung der weiblichen Hauptfigur, die mit ihrem Herkunftsland, das ebenfalls von Besatzern geprägt war, gebrochen hat und von ihrer Zukunft, auch mit R., Abstand nimmt. Sie erscheint am Ende als Opfer der lähmenden Wirkung des Phosphatstaubs, der von der nahegelegenen Mine herüber weht, was ihre ohnehin latente Tendenz zur Versteinerung, von der die Rede war, praktisch umsetzt – eine Verwandlung, die Wandelbarkeit nicht ausschließt.
Die Handlungsskizze sollte demonstrieren, daß es sich hier um keinen biographischen oder autobiographischen, keinen historischen oder dokumentarischen Roman handelt, wie sie heute an der Tagesordnung sind. Als literarisches Modell käme die Parabel in Frage, der Roman weist aber, wie bei Kafka und Ransmayr, keine Lehre auf. Die Bedeutung des Textes besteht denn auch nicht im Epischen, sondern auf der Umsetzung von extremer Erfahrung und Erinnerung in Sprache: Zum Einen im Sezieren der menschlichen Wahrnehmungs- und Resonanzvermögen: Sehen, Hören, Sprechen, Tasten, Schmecken; kunstvoll wird deren Irritation in der Einöde wiedergegeben und geltend gemacht. Zum Anderen liegt der Schwerpunkt der sprachlichen Leistung in den unaufhörlichen Perioden, die strenger Ausdruck auktorialer Perspektive sind – Dialoge gibt es nicht, obwohl das Gespräch die Beziehung des Paares konstituiert –, unterbrochen nur von der indirekten Rede des Apothekers und der Kunden. Der Text hat gleichwohl den Gestus einer mühsamen Mündlichkeit, die der Darstellung des äußeren und ‚inneren Auslands‘ dienen soll, das mit den langatmigen Sätzen allererst zu erobern ist. Die Leistung wird dadurch erhöht, daß der Autor versucht, Simultanität der drei Zeitebenen einzufangen, was bekanntlich sprachlich nicht möglich ist. Dafür kommt ihm, paradoxer Weise, seine filmische Erfahrung zu Hilfe, wenn eine kaleidoskopartige Wirkung vom Wirklichen abstrahierter Linien und „Arabesken“ die Zeitdifferenz überspielen soll. Sprache wird auch thematisch, insofern das Paar sich über die unterschiedlichen Verfahrensweisen seiner Herkunftssprachen auseinandersetzt (vgl. das meisterliche Kapitel „Fremdsprache (1)“ über die persönlichen Fürwörter – ein Lehrstück für den interkulturellen Dialog).
In: PARK, Zeitschrift für Neue Literatur, Hg. von Michael Speier, Heft 68, Berlin, Dezember 2015
Uwe Schütte
Feinstaub
Ein Mann und eine Frau, in einem unbestimmbaren Wüstenland. Es ist unklar, warum es sie dorthin verschlagen hat. Der gelungene Debütroman von Axel Ruoff lässt den Leser in beständiger Unsicherheit, was in "Apatit" überhaupt passiert. An die Stelle einer Handlung tritt zunehmend das Agieren der lebensfeindlichen Landschaft, die mit den dort lebenden Menschen ihren Prozess macht. Der Ausgang: stets negativ für die Betroffenen. An die Stelle eines konventionell-realistischen Erzählens setzt der 1971 in München geborene Autor eine Öffnung in naturgeschichtliche Dimensionen und ein literarisches Überschreiten der Grenze zwischen Organischem und Anorganischem.
Mit Sprachgewalt und Stilgefühl erforscht sein bemerkenswerter Text etwa ein Thema wie das geheime Leben der Steine und verschränkt dabei politische Gegenwart mit Naturphilosophie, das individuelle Leben seiner Figuren mit dem Schicksal der menschlichen Spezies.
Durchwirkt wird Axel Ruoffs fesselnder Roman vom Staub, der - trotz aller Versuche, ihn fernzuhalten - so unaufhaltsam überall eindringt, wie diese evokative Prosa in das Bewusstsein der Leser.
In: Wiener Zeitung, 2./3. Jänner 2016
(http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/literatur/buecher_aktuell/793371_Feinstaub.html)Anton Distelberger
Der ruhigen Kraft dieser Sätze vertraut sich der Leser gerne an und lässt sich von ihnen in ein westafrikanisches Land entführen, dessen Namen niemals fällt, obwohl sich darin durchaus das von Marokko widerrechtlich besetzt gehaltene Westsahara erkennen ließe. Der Verzicht auf die Benennung des Schauplatzes sowie auf jedes Lokalkolorit lässt den Hintergrund, vor dem sich die beiden Protagonisten bewegen, seltsam zeitlos und unwirklich geraten, wie ihnen der Erzähler auch bloß ihre Initialen zugesteht. Der landschaftliche Hintergrund nimmt weiter überhand, je mehr wir über die Herkunft und Vergangenheit des Paares erfahren, das Europa hinter sich gelassen hat.
Einerseits kämpfen sie gegen atmosphärisches Unbill an, trotzen einer übermächtigen Insektenwelt und verfluchen den allgegenwärtigen Sand, andererseits sehen sie sich immer weniger imstande, diesen einzigen festgefügten Ort zu verlassen, an dem sie sich noch stärker in ihre Ängste und Vorstellungen verstricken und damit zu Gefangenen mutieren. Die Flucht aus einer ausweglos erscheinenden Situation, der sich das Paar durch die freiwillige und selbstgewählte Isolation an diesem unwirtlichen Platz selbst ausgeliefert hat, gelingt der Frau durch eine spektakuläre Transformation. Damit entzieht sie sich aller Nachstellungen und Zumutungen.
Absichtsvoll entkleidet der Autor seine Geschichte jener Details, die ein exotisches Flair erzeugen könnten, und verstärkt damit das Unheimliche, Fremdartige der Situation. Als wahrhaft gefährlich stellen sich nicht die widrigen Umweltbedingungen heraus, sondern die Abgründe der eigenen Seele, das Grauen, das in uns wohnt.
Sigmund Freud erzählt in seinem Essay „Das Unheimliche“ (1919) davon, wie er selbst sich einmal auf ähnliche Weise in einer bedrängenden und albtraumhaften Situation gefangen sah: „Als ich einst an einem heißen Sommernachmittag die mir unbekannten, menschenleeren Straßen einer italienischen Kleinstadt durchstreifte, geriet ich in eine Gegend, über deren Charakter ich nicht lange in Zweifel bleiben konnte. Es waren nur geschminkte Frauen an den Fenstern der kleinen Häuser zu sehen, und ich beeilte mich, die enge Straße durch die nächste Einbiegung zu verlassen. Aber nachdem ich eine Weile führerlos herumgewandert war, fand ich mich plötzlich in derselben Straße wieder, in der ich nun Aufsehen zu erregen begann, und meine eilige Entfernung hatte nur die Folge, daß ich auf einem neuen Umwege zum drittenmal dahingeriet. Dann aber erfaßte mich ein Gefühl, das ich nur als unheimlich bezeichnen kann, und ich war froh, als ich unter Verzicht auf weitere Entdeckungsreisen auf die kürzlich von mir verlassene Piazza zurückfand.“ Freud leitet daraus den Schluss ab: „Dieses Unheimliche ist aber der Eingang zur alten Heimat des Menschenkindes, zur Örtlichkeit, in der jeder einmal und zuerst geweilt hat.“
Ruoff, dessen Buch es auf die Shortlist zum Preis der Rauriser Literaturtage 2016 geschafft hat, ist ein radikaler Erzähler, der seine Figuren in immer groteskere Abhängigkeiten manövriert, die Geschichte konsequent vorwärts treibt und unerschrocken bis zu ihrem dramatischen Ende forterzählt.
Anton Distelberger (http://www.bibliothekderprovinz.at/autor/toni-distelberger/)